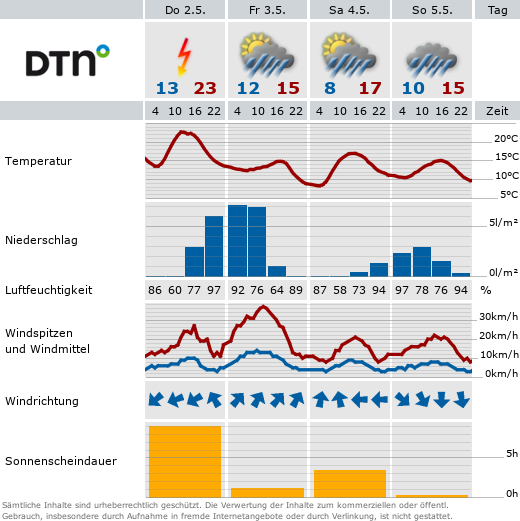Im Gespräch mit der ersten Frauenbeauftragten
1988 nahm Doris Reich ihre Tätigkeit als Frauenbeauftragte an der damaligen Universität Dortmund auf. Zum 30-jährigen Bestehen der Gleichstellungsarbeit an der TU Dortmund haben wir Doris Reich zu einem Gespräch getroffen und mit ihr über ihr Engagement für eine geschlechtergerechte Universität und die Anfänge des Gleichstellungsbüros gesprochen.
Frau Reich, Sie waren von 1988-1989 die erste Frauenbeauftragte der damaligen Universität Dortmund.
„Wir waren ein Team von vier Frauen, das ist mir wichtig zu betonen. Wir hatten ein egalitäres Prinzip und haben gesagt, dass wir alle vier Gruppen repräsentieren wollen: die Studentinnen, die Nicht-Wissenschaftlerinnen, die Mittelbauerinnen und die Hochschullehrinnen. Die Statusgruppen durch die unterschiedlichen Personen zu vertreten, war auch deshalb so wichtig, weil die Problemlagen verschieden waren.
Im Juni 1988 wurden wir offiziell zum Team der Frauenbeauftragten. Zu diesem ersten Team gehörte Michaela Basner als Nicht-Wissenschaftlerin, sie war technische Zeichnerin am Bauwesen. Birgit Frielinghaus war eine Studentin die wie ich aus der Fakultät Raumplanung kam. Die Hochschullehrerinnen wurden von der Psychologie-Professorin Sybille Volkmann-Rauhe vertreten. Und ich war als Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen dabei. Wir waren der Meinung, dass es neben den Frauenbeauftragten in den Kommunen auch Frauenbeauftragte an den Hochschulen geben müsste.“
Wie nahm die Gleichstellungsarbeit an der Universität Dortmund ihren Anfang?
„Das Amt der Frauenbeauftragten war in den 1980er Jahren noch nicht in der Hochschulgesetzgebung verankert, das kam erst später. Bei uns an der Universität Dortmund kamen die Bestrebungen, ein solches Amt einzurichten, ganz klar von unten und wurden später von der Universitätsleitung aufgegriffen. Die Grundordnung der Universität Dortmund wurde erst nach meiner Amtszeit so geändert, dass es eine Frauenbeauftragte und eine Stellvertreterin geben muss. Hier hieß es dann: ‚Auf Vorschlag der weiblichen Universitätsmitglieder, wird die Frauenbeauftragte und ihre Vertreterin für eine Amtszeit von zwei Jahren vom Senat gewählt und vom Rektor bestellt.‘
Es gab an der Universität Dortmund also zuerst das Team der Frauenbeauftragten und dann die institutionelle Verankerung. Wir haben das Anliegen in die Gremien getragen, auf unsere Initiative wurde das Amt dann offiziell eingerichtet. Zusammengefasst gab es eine große gesellschaftliche Strömung außerhalb der Universität, dann gab es innerhalb der Universität Personen, die das Thema Gleichstellung vorangetrieben haben. Hinterher kam man nicht mehr drum herum, dem auch nachzugeben und es zu verankern. In dem ganzen Prozess gab es nicht direkt Widerstände oder dass einem Steine in den Weg gelegt wurden, aber er war schon sehr zäh. Von einigen Personen gab es auch Gegenwind, das Thema war nicht von allen geliebt. Vor allen Dingen im Senat gab es Leute, die keine Lust hatten sich auch noch mit dem Frauenthema zu beschäftigen. Aber ich glaube es war genug Power von unten da, um nicht locker zu lassen.“
Sind Sie schon frauenbewegt an die Universität gekommen?
„Nein, nein. Im Studium war das alles noch kein Thema für mich, das begann erst mit meiner Berufstätigkeit. Also ich denke, dass dies auch mit außeruniversitären Bestrebungen etwas zu tun hatte. Ich habe zum Beispiel die Entwicklungen gegen § 218 mitbekommen. Es war ja die Zeit, als Frauen auf die Straße gingen oder Veröffentlichungen gemacht haben. Es gab eine sehr rührige Szene von Frauen im Ruhrgebiet, an der Volkhochschule gab einen Bereich der Bildung für Frauen, es wurden Gesprächskreise angeboten usw. In Dortmund gab es auch ein erstes Frauenzentrum. Es war eben eine Zeit, wo sich sehr vieles getan hat. So auch an der Universität.
Ich habe 1971 angefangen zu studieren. Ich bin die älteste von drei Töchtern und die erste, die studiert hat. Meine Eltern haben mir keine Steine in den Weg gelegt, obwohl dies die Zeit war, in der Frauen ohne Erlaubnis ihres Ehemanns nicht berufstätig sein oder ein eigenes Konto eröffnen durften. Im Studium war es dann schon auffällig, dass wir wenige Frauen waren. Am Anfang waren wir Frauen dann eher bestrebt, nicht aufzufallen unter den vielen Männern. Wir hatten in der Raumplanung auch nur eine Professorin damals, die war im Bereich Soziologie tätig. Das war Frau Prof. Spiegel. Sie war die erste Professorin an der Universität Dortmund und für mich ein wichtiges Vorbild. Prof. Spiegel bearbeitete das Thema ‚Familie und Wohnen‘.
1977 habe ich mein Studium abgeschlossen. Der Abschluss, den ich damals verliehen bekam, hieß noch ‚Diplom-Ingenieur‘. Als es dann in den 80er Jahren die Möglichkeit gab, habe ich ihn zur ‚Dipl.-Ingenieurin‘ umschreiben lassen. Nach meinem Abschluss war ich fast zehn Jahre lang, mit kurzen Unterbrechungen, an der Universität in Dortmund tätig. Nach den Tagungen der Frauenstudien haben wir regelmäßig Studienprojekte für Studentinnen und Ringvorlesungen angeboten, die wir ehrenamtlich mit der Fachschaft Raumplanung organisiert haben. Dann gab es einen neuen Professor in der Soziologie, der das wohlwollend zur Kenntnis genommen hat. Als bei ihm eine Stelle frei wurde, habe ich mich mit dem Schwerpunkt ‚Frauenforschung in der Raumplanung‘ darauf beworben. Ich hatte vier Jahre lang die Möglichkeit diesen Bereich im Fachgebiet ‚Soziologische Grundlagen der Raumplanung‘ aufzubauen. Der Schwerpunkt hat dazu geführt, dass es mit Frau Prof. Becker eine ganze Weile eine Professur dazu gab.
Weil ich an der Universität über zehn Jahre nur befristete Zeitverträge bekommen habe, habe ich 1990 von der Uni zu unserem Planerinnenverein gewechselt. Als FOPA, feministische Organisation von Planerinnen und Architektinnen, hatten wir ein Büro in Dortmund aufgebaut. Die Arbeit des Vereins begann schon ein paar Jahre vorher. Neben meiner Hochschultätigkeit war ich auch immer im Vorstand des Vereins. Ein Anliegen der FOPA war es, bezahlte Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen. Damals gab es ja auch das Instrument der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, kurz: ABM. Wir haben das gedeutet als ‚Arbeit bezahlt machen‘. Wir wollten so auch ungewöhnliche Themen für Frauen erschließen, die gesellschaftlich noch nicht gefördert wurden.
In späteren Jahren habe ich mich mit einer Kollegin selbstständig gemacht. Wir hatten ein Büro in Dortmund. Ich hatte auch die Gelegenheit eine Gastprofessur in Kassel zu übernehmen. Da waren die frauenspezifischen Belange in der Raumplanung auch das zentrale Thema.“
Was war ihre persönliche Motivation, das Amt der Frauenbeauftragten an der Universität Dortmund zu übernehmen?
„Ich bin als Abiturientin nach Dortmund gekommen, um hier Raumplanung zu studieren. Ich war damals 19 Jahre alt und kam aus Niedersachsen, weil mich dieses neuartige Studium der Raumplanung interessiert hat. Wir waren damals ganz wenige Frauen in diesem Jahrgang, die überhaupt Raumplanung studiert haben. Da gab es in der Emil-Figge 50 schon mehr Frauen. Außerdem gab es natürlich den Arbeitskreis Wissenschaftlerinnen NRW an der Universität Dortmund und das Bemühen, die Frauenstudien zu etablieren. Diese Frauen haben auch das große Frauenforum im Revier organisiert. Davon hatten wir gehört und haben dann Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir uns gefragt, wie es eigentlich mit Frauen in der Planung aussieht: Sowohl auf der Seite der Betroffenen - wie wirkt sich das da aus? - als auch in der Profession - wie ist das eigentlich mit Architektinnen und Planerinnen in diesem Berufsfeld? Wer waren die Ersten und wie hat sich das entwickelt? Ich habe auch in den folgenden Jahren immer beruflich verfolgt, wie sich der Anteil der Frauen in der Planung entwickelt hat. Später habe ich das Thema auch zwei Mal durch Studien begleitet. Zum einen habe ich mit einem Kollegen zusammen eine Verbleibsstudie über diejenigen gemacht, die in Dortmund Raumplanung studiert haben. Wir haben uns gefragt, wo sie untergekommen sind, und haben da auch die Frauen besonders in den Blick genommen. Später hatte ich noch einmal Gelegenheit, für das Landesministerium eine Studie durchzuführen über Berufschancen, Arbeitsmarktchancen von Frauen in der Architektur und Planung.“
Mit wem haben Sie an der Universität zusammengearbeitet? Wer hat Sie unterstützt? Und wo hat es vielleicht auch „gehakt“?
„Wir waren nicht alleine. Es gab dieses Netzwerk von Wissenschaftlerinnen was parallel arbeitete. Der Arbeitskreis Wissenschaftlerinnen NRW wurde von Prof. Sigrid Metz-Göckel im Hochschuldidaktischen Zentrum ins Leben gerufen. Sie war eine echte Förderin. Das Hochschuldidaktische Zentrum war uns insgesamt eine große Hilfe. Da war mehr Apparat und Power, da gab es ein Kopiergerät, man konnte Briefe verschicken, man konnte das Telefon benutzen. Es gab ja eben noch kein Büro für die Frauenbeauftragten.
Auch der damalige Rektor Herr Prof. Velsinger, auch ein Raumplaner, war in dieser Zeit ein Unterstützer. Ich kann mich erinnern, dass wir auch im Rektorat vorgesprochen haben und das Thema Gleichstellung bei ihm auf offene Ohren stieß. Aber man musste ja auch den formalen Gang gehen und das hat dann eben zwei Jahre gebraucht, bis die Änderung der Grundordnung im Senat abgesegnet wurde.
Aber natürlich gab es innerhalb der Universität verschiedene Fraktionen. Da waren die einen, die das ganz schlimm fanden, und die Befürworter. Und dann gab es noch die, denen das Thema egal war.“
Heute ist das Gleichstellungsbüro der TU Dortmund räumlich, sachlich und personell auskömmlich ausgestattet. Wie war das zu Ihrer Zeit?
„Die Arbeit insgesamt war nicht einfach, wir hatten wie gesagt kein Büro und wir hatten kein Geld. Wir haben das alles ehrenamtlich gemacht. Es war nur unser Engagement, was das Ganze getragen hat.“
Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten tragen das Thema Geschlechtergerechtigkeit heute auch in die Fakultäten. Gab es zu Ihrer Zeit eine Zusammenarbeit mit den einzelnen Fakultäten?
„Die Universität war zu diesem Zeitpunkt ja auch gar nicht mehr so klein. Also haben wir gesagt, dass es gut wäre auch Ansprechpartnerinnen in den einzelnen Fachbereichen zu haben, die hießen ja damals noch nicht 'Fakultäten'. Im Sinne eines Netzwerkes sollte alles so auch ein bisschen leichter gehen, zum Beispiel die Einladungen, die Flugblätter und die Aushänge überall hin zu bringen.“
Heutzutage hat die Gleichstellungsbeauftragte vielfältige Aufgaben. Wie war das zu Ihrer Zeit?
„Es gab in dieser Zeit keine Arbeitsplatzbeschreibung oder Ähnliches für das Amt der Frauenbeauftragten. Wir haben erstmal alle Themen aufgegriffen, die so anlagen. Ein Thema war zum Beispiel die Situation der Studentinnen mit Kindern. Die studentische Vertreterin hat sich da stark mit beschäftigt. Es gab auch Vernetzungen mit anderen Universitäten. So haben wir im April 1989 eine große Tagung an der Universität Dortmund abgehalten. Das Hochschuldidaktische Zentrum und wir Frauenbeauftragten haben im Gästehaus zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. Es trafen sich 90 Hochschulfrauenbeauftragte aus allen Bundesländern an unserer Universität zu einem ersten Austausch (Anm. d. Red.: 1. Bundeweites Hochschulfrauenbeauftragten-Treffen). Das war die erste BuKof, die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen. Das haben wir mit den anderen organisiert, um zu schauen wie es in den anderen Bundesländern aussieht.
Ein wesentlicher und wichtiger Punkt, der erst mit der Institutionalisierung kam war, dass die Frauenbeauftragte bei Einstellungsgesprächen dabei sein konnte. Das durften wir noch nicht. Bei den Hochschullehrerinnen war es schon so, dass sie geschaut haben, dass sie Frauen in die Berufungskommissionen kriegen, damit wenigstens in diesem Gremium Frauen gesessen haben. Das war aber auch nicht immer so einfach.“
Und welche Themen haben Sie in Ihrer Arbeit als Frauenbeauftragte für die wissenschaftlich Beschäftigten bearbeitet?
„Mir war damals wichtig, erst einmal den Blick dafür zu schärfen, dass Frauen immer noch in einer drastischen Minderzahl an der Universität sind; auch im Mittelbau. Die Professorinnen haben eher gekämpft, dass sie Sonderforschungsbereiche bekommen und Professuren speziell für Frauen ausgeschrieben wurden. In dieser Zeit war es wichtig erst einmal zu schauen, rein quantitativ, wie der Anteil der Studentinnen, der Anteil der weiblichen wissenschaftlichen Beschäftigten und der Anteil der Professorinnen ist. Der Frauenanteil auf der Ebene des wissenschaftlichen Mittelbaus war damals von Fachgebiet zu Fachgebiet sehr, sehr unterschiedlich. In der Raumplanung war er damals nicht so hoch. Im Maschinenbau und im Chemieingenieurwesen war der Anteil noch viel geringer, als in der Raumplanung.
Um alle Frauen zu erreichen, haben wir sogenannte ‚Frauenvollversammlungen‘ abgehalten. Die fanden dann meistens hier am Campus statt. Wir haben diese Vollversammlungen über alle vier Gruppen gemacht, meistens in der Emil-Figge-Str. 50.
Ich fand es damals und finde es immer noch sehr wichtig, auch die Männer mit ins Boot zu holen. Männer sollten für Berufsfelder wie Kindergarten, Grundschule oder die Pflege sensibilisiert werden. Ich lebe mit drei Männern zusammen, ich habe zwei Söhne. Es war damals so, dass ich die Stelle an der Uni hatte und schwanger wurde. Mein Mann hatte gerade frisch eine Stelle in einem Rechenzentrum bekommen und ich habe gesagt: ‚Wenn ich jetzt weniger arbeite ist das ganz schlecht. Die Uni spart das nur ein.‘ Wir waren so engagiert in unseren Berufen und wollten schauen, ob wir das nicht hinkriegen. Und dann haben wir beschlossen, dass mein Mann zeitlich begrenzt seine Stelle reduziert, um sich auch um seinen Sohn kümmern zu können. Das war in einer Zeit, wo es keine Elternzeit gab, aber sein Chef war einverstanden. Mein Mann hat sich dann seine Stelle mit einem jungen Informatiker geteilt, eigentlich war es sogar mehr als eine Stelle, weil sie die Woche geteilt haben. Der eine hat von Montag bis Mittwoch und der andere von Mittwoch bis Freitag gearbeitet. Einen Tag waren sie zusammen da und haben sich sonst am Telefon abgesprochen. Und auch die anderen Aufgaben haben wir uns natürlich geteilt. Wenn also der Elternsprechtag am Donnerstag war, dann ist er dorthin gegangen und wenn ein Kinderarztbesuch in seine Zeit fiel, dann ging er natürlich mit dem Kind zur Impfung. Dieses Modell war zu der Zeit sehr, sehr ungewöhnlich. Es war nicht einfach und es war anstrengend, aber es war uns wichtig.“
Sie haben das Amt der Frauenbeauftragten nach einem Jahr abgegeben, weil Sie dann die Universität verlassen haben. Wenn Sie heute dreißig Jahre zurück blicken, würden Sie sagen, dass Sie diese Pioniersaufgabe noch einmal übernehmen würden?
„Ja, doch. Ich glaube schon.“